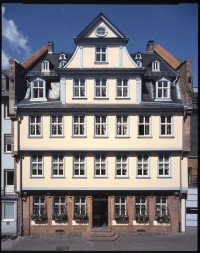Material/Technique
Bleistift, gewischt, zur Erzeugung von Weißhöhungen geschabt, auf Papier Pellée
Provenienz:
Nach 1814-1850 Allwina Frommann (1800-1870) [1]
1850 Wilhelm Ludwig Hertz (1822-1901), Verlagsbuchhändler in Berlin, als Geschenk erhalten von Allwina Frommann. [2]
[…] Elisabeth Hertz (1827-1865), geb. Martins, verheiratet mit Prof. Martin Hertz (1818-1895), Breslau, als Geschenk von ihrem Schwager Wilhelm Ludwig Hertz erhalten [3]
- 1895 Prof. Martin Hertz (1818-1895), im Erbgang von seiner Frau Elisabeth Hertz erhalten
- 1909 Antonie Hertz (1838-1909), verwitwete Regenbrecht, zweite Ehefrau von Prof. Martin Hertz, im Erbgang von ihrem Mann Martin Hertz erhalten
1919 Dr. Wilhelm Hertz (1874-1951), Friedberg, im Erbgang und durch Schenkung erhalten von seiner Mutter Antonie Hertz [3]
1919 Dr. Wilhelm Hertz (1874-1951), Friedberg, im Erbgang und durch Schenkung erhalten von seiner Mutter Elisabeth Hertz [3]
16.12.1942 Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum, erworben von Wilhelm Hertz als Schenkung [4]
[1] Entstehungszeit des Gedichts wohl vor Januar 1814, datiert auf den 9.1.1814. S. Provenienzmerkmal, s.u.
[2] Der Vermerk „W. Hertz inv. 1850“ (=inventit) deutet daraufhin, dass die Umrahmung von Allwina Frommann auf seine Veranlassung hin 1850 entstand. Vgl. auch Wilhelm Hertz: Goethes Epigramme „Grabschrift“ und „Lähmung“. In: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Weimar 1921, hier S. 61-70, mit Abb. auf S. 63.
[3] Vgl. Provenienzmerkmal (s.u.) und Inventaranlage zu Hs-29540
[4] Vgl. Inventarbuch
Provenienzbewertung:
Grün: Provenienz unproblematisch
![Die Steilküste von Helgoland mit der Langen Anna bei Sturm [Aus dem Album der Alwine Frommann] (Freies Deutsches Hochstift CC BY-NC-SA)](https://asset.museum-digital.org/hessen/images/1/202204/72200/die-steilkueste-von-helgoland-mit-der-langen-anna-bei-sturm-aus-dem-album-der-alwine-fromm.jpg)