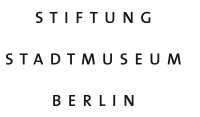Die frühklassizistische Uhr folgt dem Beispiel französischer Uhren aus der Zeit um 1790. Auf einem Sockel, der seitlich flache kannelierte Säulen zeigt, erhebt sich ein Säulenstumpf, der in einem Zylinder das runde Uhrwerk trägt. Auf dem Zylinder sitzen rücklings aneinander gelehnt und sich an den Händen fassend zwei weibliche Figuren, deren Unterkörper in Akanthusblättern enden. In deren Mitte erhebt sich eine Blumenschale, aus der wiederum zwei Pflanzenranken sich winden. Die Bohrungen an den Enden verweisen auf eine Zutat, die nicht mehr vorhanden ist.
Auf zwei kleinen eckigen Säulen am Sockel hinten ruht die sich nach oben verjüngende Rückwand, die der Zylinder nach hinten durchbricht. Die ursprüngliche Bekrönung ist verloren. Der Sockel und auch der Säulenstumpf wurden aus weißem Marmor gefertigt. Am Sockel in den seitlichen Säulen sind die Kanneluren mit feuervergoldeten Applikationen halb gefüllt, die Stufen am Sockel mit vergoldeten Perlstäben hervorgehoben. Im Rechteck auf der Vorderseite des Sockels ist eine länglich ovale messingene Plakette, die für eine Gravur bestimmt war. Der Uhrenzylinder mit seinen Lünetten hinten und vorn, je mit einem originalen bombierten Glas, ist aus feuervergoldetem Messingblech. Die beiden weiblichen Figuren mit Blumenschale wurden gegossen und sind ebenfalls feuervergoldet. Die schwarze Rückwand, die als Begrenzung zu deuten ist, besteht aus Korallenkalk/Kohlenkalk und vermittelt den Eindruck eines Denkmals.
Über Jacques Hovelac ist wenig bekannt. Er wird als Großuhrmacher bei Gerhard König erwähnt und in der Deutschen Uhrmacherzeitung von 1936 Nr. 25 als Berliner Kaufmann und „rechtlicher Mann“ (wohl: rechtschaffender Mann) geschildert. 1783 übernahm er als Direktor die bereits marode Königliche Uhrenmanufaktur und führte sie bis zu seinem Tod 1802 weiter. Da er Eigenkapital mitbrachte, schenkte ihm Friedrich II. 6.000 Taler. Später erhielt er vom Preußischen Staat bis zu 28.000 Taler zinslos sowie eine Abgabefreiheit, um das Unternehmen zu stabilisieren. Doch auch die Umstellung nach erfolgloser Taschenuhrerzeugung auf die Fabrikation von Konsol- und Tischuhren brachte nicht den erhofften Gewinn. Die Genfer Konkurrenz war zu stark. Die Zahl der Arbeiter sank weiter, 1792 waren es nur 14, davon 9 in Friedrichsthal. Bis 1783 wird die Königliche Uhrenfabrik mit dem Direktor Ludwig Truitte in den Adressbüchern erwähnt. 1784 nur mit „ist auf dem Werder ohnweit Rollets Hof“. 1785 ist sie dort nicht mehr verzeichnet. Jacques Hovelac wird in diesen Jahren und auch davor in den Adressbüchern nicht erwähnt. Leider gibt der Autor und Uhrmacher Gerhard König in seinen Publikationen keine Quellen an, so dass die Herkunft der Information zu Hovelac im Dunkeln bleibt.
Man kann davon ausgehen, dass die signierte Kaminuhr noch vor 1790 entstanden ist, da ein technisches Detail, nämlich die Spindelhemmung, ungewöhnlich altmodisch für die Zeit ist. Das Märkische Provinzialmuseum, die heutige Stiftung Stadtmuseum Berlin, kaufte die Uhr 1918 beim Antiquitätenhändler Oskar Weishaupt in Potsdam, Schlossstr. 4 an. (Marina de Fümel)